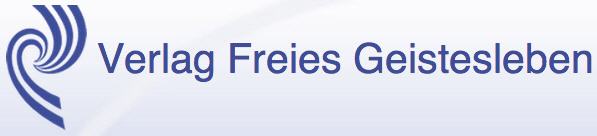Liebe Leserinnen und Leser,
»Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen, / Und jedermann erwartet sich ein Fest« – beklagt sich der Theaterdirektor im Vorspiel zu Goethes »Faust« beim Dichter über den Druck des Publikums. Dieses sei, so meint er weiter, zwar an das Beste nicht gwohnt, habe aber doch schrecklich viel gelesen. So dreist bin ich nicht, den ersten Teil der Unterstellung hier auf Sie zu übertragen, der zweite aber stimmt gewiss. (Vielleicht haben Sie sogar 1001 Buch 2|2002 gelesen, in der wir schon einmal über’s Theater erzählt haben.) Die anschließende Frage des Direktors – »Wie machen wir's, daß alles frisch und neu / Und mit Bedeutung auch gefällig sei?« musste ich mir also auch stellen. Ob das gelungen ist, entscheiden Sie nach der Lektüre dieser Ausgabe von 1001 Buch. Dass aber Jacky Gleich, die auf der 1002. Seite links von mir die ersten Scheinwerfer auf zwei große Bühnenfiguren richtet, dafür auch den ersten Applaus verdient hat, daran zweifle ich nicht.
Auch in unserem Vorspiel kommt i. Ü. mit Ulrich Hub ein Dichter auf der Bühne. Er muss aber kein Stück abliefern, sondern Auskunft geben. Peter Rinnerthaler hat mit ihm, dessen Theaterstücke – etwa »An der Arche um Acht« – nicht nur häufig gespielt werden, sondern auch als Prosatexte höchst erfolgreich sind, über das Schreiben für Bühne und Buch, Erwachsene und Kinder gesprochen. Danach steht im ersten Akt das Bilderbuch im Rampenlicht. Das, wie Claudia Sackl feststellt, per se über dramaturgische Elemente verfügt. Ist dann im Buch auch noch Theater Gegenstand, kommt es zu einem vielstimmigen Wechselspiel zwischen den Medien Theater und Bilderbuch. Das betrifft die Gestaltung wie die Rezeption. Ersterem widmet sich Silke Rabus, die Bilderbücher vorstellt, in denen aus Kartons Hausmodelle gebaut und Fundstücke zu Requisiten des Erzählens verwendet werden. Auf diesen dreidimensionalen Bühnen werden dann gut ausgeleuchtet unterschiedlichste Stücke inszeniert. Die sich wiederum wunderbar dafür eignen, mit dem Kamishibai präsentiert zu werden. Reinhard Ehgartner stellt die wesentlichen Qualitäten dieser Form des bildgestützten Erzählens vor. Das Spiel kann beginnen – und es ist gemeinsames Spielen. Wie im Theater sind auch bei einer Kamishibai-Aufführung alle Anwesenden am Ereignis beteiligt. Für Kinder ist das kein Problem, schließlich sind schon kindliche Spiele wie auch erste ästhetische Spracherfahrungen – Abzählverse, Fingerspiele – mit einem dramaturgischen Ablauf verknüpft, meint Johannes Mayer in seinem Beitrag über Kinder im Theater.
Im Zwischenstück kommen Kritiker zu Wort. Stefan Busz haben wir um eine Besprechung der Aufführung von Heinrich Heines »Der arme Peter« in Peter Schössows gleichnamigen Bilderbuch gebeten. Er hat den Auftrag erfolgreich weitergegeben an den Bären in Reihe 6. Dass auch erwachsene KritikerInnen nicht kühl und distanziert sind, sondern erstaunt, gerührt, entsetzt, zeigt Sonja Loidls Bericht über das zentrale Theaterereigniss des Jahres. Damit sind wir zurück auf jenen Bühnen, die auch elementare Bestandteile und Motive der Kinder- und Jugendliteratur sind. Christina Ulm hat mit Figuren mitgefiebert, die sich in Rockstars verlieben oder selbst zu Bühnenstars werden – und sei es nur im vorweihnachtlichen Krippenspiel in der Schule. Auch damit kann man länger als 5 Minuten berühmt werden, wie die Herdmanns gezeigt haben. Die jedoch auch auf der Bühne keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie die sehr sehr schlimmen Herdmann-Kinder sind. Und maximal Jesus-und-Maria-Darsteller, nicht wirklich also Marvel-Superhelden. Deren Maskerade ja anders funktioniert als auf dem Theater: Die Maske dient Spiderman & Co. nicht dazu, jemand anderen darzustellen, sondern den Menschen dahinter zu verbergen. Mehr über das Maskieren und Verstecken lesen Sie bei Aleta-Amirée von Holzen.
Der Gong kündigt den nächsten Akt an: Nicht nur weil Shakespeare in einem Bühnenheft dazu gehört, stellt sich Bruno Blume auf ebendiese und beichtet, warum er fünf von dessen Dramen in Prosastücke gefasst hat – und wie es ihm dabei ergangen ist. Und Heidi Lexe führt uns vor, dass der Superstar aus Stratford-upon-Avon ohnehin überall mit dabei ist, also auch in Erzählungen für Jugendliche. Ihre Reise beginnt mit »Quaken oder nicht quaken« in Australien und endet mit einem Prospero, der in einer Graphic Novel aus Wien die Deleaturtaste drückt. Jubel auf den Rängen.
Zum Abschluss folgt noch einmal ganz großes Theater: Der deutsche Illustrationskünstler Wolf Erlbruch wurde 2017 mit dem Astrid Lindgren Memorial Award ausgezeichnet. Stephanie Jentgens unternimmt eine Würdigung. Stehende Ovationen.
Bevor sich der Vorhang endgültig senkt, wird noch einmal um Aufmerksamkeit gebeten: Auf die Bühne treten unsere RezensentInnen und bringen ausgewählte Bücher aus dem laufenden Herbst mit.
Dann ist es vorbei. Stellvertretend für alle an diesem Stück Beteiligten – nicht nur die HauptdarstellerInnen, die namentlich im Programm genannt sind, sondern auch Bühnenarbeiter im Hintergrund (Presseleute, die uns mit Bildmaterial versorgen, Graphikerin, Korrektorin, Drucker, die Kollegin an der Abokasse …) – bedanke ich mich. Und gehe ab. In der Hoffnung, dass Sie mir nicht mit Berthold Brecht nachrufen: »Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen.«
Franz Lettner
Ein Kinderspiel für einen Bären
Eine Kritik von Heinrich Heines "Der arme Peter" in der Inszenierung von Peter Schössow
ICH BIN DER TEDDY in Reihe drei, Platz sechs (siehe Illustration von Peter Schössow auf der rechten Seite). Im Thalia Theater wird »Der arme Peter« nach Heinrich Heine gegeben, ein Spiel von Kindern für Kinder. Ein Kind sitzt auch links neben mir. Mein rechter Platz ist noch frei, dann kommt die Aufpasserin – wenn Kinder für Kinder spielen, sind Erwachsene nicht weit. Ein Roboter ist auch da, er sitzt in Reihe vier und isst gerade ein Eis. Die Kinder aber tun im Theater, was Kinder im Theater immer tun: Sie sind voller Vorfreude auf das, was kommt. Nur einer ganz vorne in der Mitte findet schon jetzt alles fad. Doch »Der arme Peter« ist nichts für Bubis.
…
Den gesamten Beitrag lesen Sie in 1001 Buch 4|17.
Als AbonnentIn auch online direkt hier auf dieser Website
Wer ist Herr Meier?
HERR MEIER ist nicht mehr jung, hat eine Halbglatze, an deren Seiten einzelne blonde Strähnen abstehen, und eine runde Brille auf der Nase. Darunter sitzt ein freundliches Lächeln. Herr Meier – gewandet in einen japanischen Kimono und mit einer Bambusfeder in der Hand – malt Katzen, er schneidet auch gern Faltgirlanden-Männchen oder spielt im Bett Mundharmonika. Das sind einige seiner »zahllosen Lieblingsbeschäftigungen«.
SELBSTPORTRÄT MIT BRILLE. Herr Meier ist eine Nebenfigur im Bilderbuch »Frau Meier, die Amsel«, das Wolf Erlbruch 1995 veröffentlichte. Es erzählt die Geschichte von Frau Meier, die sich über alles Sorgen macht, bis sie eines Tages eine kleine Amsel findet, diese aufzieht, ihr das Fliegen beibringt, dabei sich selbst in die Lüfte erhebt und die Leichtigkeit des Seins findet. Herr Meier ist ihr Begleiter, an der Amsel-Aufzucht aber nur wenig beteiligt. Sein Motto: »Tu, was du nicht lassen kannst«. So lässt er Frau Meier die Freiheit, etwas Neues zu entdecken.
Keine andere Bilderbuchfigur von Wolf Erlbruch trägt so eindeutig die Züge ihres Schöpfers wie Herr Meier. Es ist das humorvolle Selbstbildnis eines Künstlers, der glücklich ist im Akt der Schöpfung, keines Tatmenschen, der hinausgeht und die Welt rettet, aber durch die kleinen Dinge des Alltags das Leben besser macht. Herr und Frau Meier sind keine glorreichen Helden, sie haben Macken, die sie nicht verbergen, und gerade dadurch sind sie uns nahe.
Die gesamte Würdigung lesen Sie in 1001 Buch 4|17.
Als AbonnentIn auch online direkt hier auf dieser Website